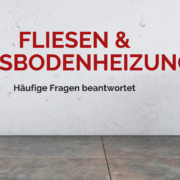Feuchtigkeit unter Fliesen: Feststellen und richtig beheben
Fliesen gelten zwar grundsätzlich als nahezu wasserfest, vor einem Wasserschaden bewahren sie aber dennoch nicht. Und der ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch teuer und sogar gefährlich werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wodurch Feuchtigkeit unter Fliesen entstehen kann, wie Sie bei der Suche nach einer feuchten Stelle vorgehen und wie Sie das Problem am besten beseitigen.
Risikofaktor Feuchtigkeit
Prinzipiell ist Feuchtigkeit in Gebäuden nichts Schlechtes, sondern sogar wichtig. In der Luft trägt sie zu einem angenehmen Raumklima bei und nahezu alle Baustoffe und Materialien behalten überhaupt erst durch die regelmäßige Aufnahme von Wasser bzw. Wasserdampf dauerhaft ihre Stabilität. Allerdings nur, solange sich die Feuchtigkeit in Grenzen hält.
Zu viel Feuchtigkeit unter Fliesen kann über kurz oder lang zu einem Wasserschaden führen – und damit unweigerlich zu einem Rattenschwanz an negativen Folgeerscheinungen. Diese betreffen weniger die Fliese selbst, als viel mehr den Untergrund, auf dem sie verlegt sind. So sind muffig riechende Räume und dunkle Flecken oder Salzausblühungen an der Wand noch das kleinere Übel. Weitaus schwerwiegender ist es, wenn der Schaden bereits den kompletten Bodenaufbau bzw. das gesamte Mauerwerk betrifft und sich darauf gar schon gesundheitsgefährdender Schimmel gebildet hat. Denn in diesen Fällen ist eine aufwändige und teure Komplettsanierung meist nicht mehr zu verhindern.
Mögliche Ursachen für Wasserschäden unter Fliesen
Grundsätzlich kann ein Wasserschaden unter Fliesen auf zwei Arten entstehen:
- Weil Feuchtigkeit unter dem Fliesen-Belag eingeschlossen wird, oder
- Weil Wasser von oben eindringt.
Für ersteres sind in der Regel unsachgemäße Fliesenlegearbeiten verantwortlich. Etwa, wenn Fliesen auf einem nicht ausreichend trockenen Bodenaufbau verlegt werden oder es nach der Verlegung zu sogenannter nachschiebender Feuchtigkeit aus dem Untergrund kommt. In diesen Fällen bleibt dauerhaft Feuchte unter den Fliesen bestehen und kann Schäden am gesamten Fußbodenaufbau verursachen. Deshalb ist insbesondere bei frisch eingebrachtem Estrich auf die Verlegereife mittels Restfeuchtebestimmung zu achten, bevor mit der Verlegung der Fliesen begonnen wird. Vor allem bei großformatigen Fliesen mit geringem Fugenanteil kommt es außerdem manchmal vor, dass die Feuchtigkeit aus dem Fugenmörtel oder Fliesenkleber nicht ausreichend entweichen kann und dadurch ebenfalls unter dem Belag verbleibt.
Die zweite Ursache für einen Wasserschaden ist, dass Nässe erst nachträglich über die Oberfläche unter die Fliesen gelangt. Sei es durch eine akute Wassereinwirkung, wie beispielsweise bei Überflutungen, Rohrbrüchen oder durch die auslaufende Waschmaschine, oder durch regelmäßige Feuchtigkeitsbelastung der Fliesen, wie es etwa durch den Wasserdampf in der Dusche bzw. im Bad der Fall ist. Dabei dringt die Feuchtigkeit allerdings nicht über die Fliese selbst ein, da das Material kaum Wasser aufnimmt, sondern über die Fugen. Egal, welches Füllmaterial verwendet wird, Fugen sind immer wasserdurchlässig – selbst mit Silikon abgedichtete Fugen können mit der Zeit brüchig oder löchrig werden und somit an Dichtheit verlieren.
Die Krux an der Sache ist somit: Unter Fliesen bleibt ein Wasserschaden in der Regel lange unbemerkt. Der Belag verdeckt die betroffene Stelle vermutlich, sodass sich das Wasser ungehindert ausbreiten kann. Und selbst wenn dann bereits ein Schaden ersichtlich ist, liegt das tatsächliche Ausmaß meist immer noch unter den Fliesen verborgen.
Umso wichtiger ist es, sich bereits beim geringsten Verdacht, spätestens jedoch bei den ersten Anzeichen auf die Suche nach der Ursache zu machen und sich durch Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts unter den Fliesen Gewissheit zu verschaffen.
Feuchtigkeit messen: So funktioniert’s
Zur Feuchtigkeitsmessung unter Fliesen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich in Aufwand und Aussagekraft unterscheiden:
Direkte Verfahren
Bei direkten Verfahren, wie etwa der zur Restfeuchtebestimmung von Estrichen bekannten Calciumcarbid-Methode (CM-Methode), wird eine Probe aus dem Baustoff entnommen, zerkleinert und in einer Druckflasche mit Calciumcarbid vermengt. Anhand der chemischen Reaktion kann dann der Feuchtigkeitsgehalt mithilfe eines Manometers ermittelt werden. Diese Methode gilt als besonders zuverlässig – und ist nebenbei auch die einzig gerichtlich anerkannte –, allerdings ist sie auch die aufwändigste und kann nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
Indirekte Verfahren
Wesentlich einfacher und daher grundsätzlich auch für den Privatgebrauch praktikabel ist hingegen die indirekte Feuchtebestimmung über Feuchtigkeitsmessgeräte. Zahlreiche Fliesen Hersteller bieten unterschiedlichste Modelle, die zum Großteil schon relativ günstig erhältlich sind. Je nach Art und Ausführung lässt sich mit diesen Geräten meist auch durch Fliesen oder andere Oberflächen hindurch Boden- oder Wandfeuchte messen.
Hierfür sind prinzipiell zwei Varianten verbreitet:
Kapazitive Messung
Bei der kapazitiven Methode erzeugt das Feuchtigkeitsmessgerät ein elektrisches Streufeld im Sensorkopf, über dessen Durchlässigkeit der Feuchtigkeitsgehalt an der jeweiligen Stelle in ca. 3 cm Tiefe ermittelt wird. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie völlig zerstörungsfrei funktioniert und beliebig oft wiederholt werden kann. Der Nachteil ist die verhältnismäßig geringe Messtiefe, wodurch die Ergebnisse bei einem tieferliegenden Wasserschaden möglicherweise nicht zuverlässig genug sind. Außerdem ist ein gewisses Fachwissen zur richtigen Interpretation der Messwerte von Vorteil, da diese durch Salze oder Metalle in den Baustoffen beeinflusst werden können.
Widerstands-Messung
Bei der elektronischen Messung nach dem Widerstandsprinzip wird Strom über Elektroden in die vermutlich feuchte Stelle geleitet. Die Leitfähigkeit des Materials gibt dann Aufschluss über die darin enthaltene Feuchtigkeit. Dabei gilt: Je höher der Widerstand, desto niedriger das Messergebnis und damit der Feuchtigkeitsgehalt. Die Vor- und Nachteile bei einem derartigen Feuchtigkeitsmessgerät: Wand oder Boden müssen an der betroffenen Stelle angebohrt werden, um die Elektroden einführen zu können, dafür kann aber auch ein tieferliegender Wasserschaden aufgespürt werden. Alternativ kann aber in der Regel auch über Fugen gemessen werden.
Dennoch ist bei der eigenmächtigen Suche nach dem Wasserschaden allgemein Vorsicht geboten. Da die Ergebnisse bei jedem Messgerät anders ermittelt und nach herstellerabhängigen Skalen dargestellt werden, gibt es keine pauschalen Normwerte. Um wirklich zuverlässige Aussagen über den Feuchtigkeitsgehalt zu erhalten, empfiehlt es sich daher grundsätzlich, einen Profi zurate zu ziehen.
Wasserschaden – was nun?
Wird ein Wasserschaden festgestellt, besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Ob es reicht, die betroffenen Stellen ausreichend zu trocknen und die Ursache zu beheben (z. B. undichte Silikon-Fugen im Bad erneuern) oder ob bereits größere Sanierungen notwendig sind, kann allerdings auch hier wieder nur ein Experte beurteilen. Denn werden die falschen Maßnahmen gesetzt, kann sich der Schaden mitunter sogar noch verschlimmern.